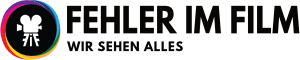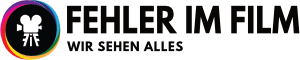Die Grundidee der Kreuzigung ist es, den Verurteilten hilflos den Elementen oder Wettergottheiten auszuliefern. Das Kreuz im christlichen Sinne gab es jedoch kaum als Hinrichtungsinstrument, da die Errichtung eines Kreuzes profunde Zimmermannskenntnisse verlangte, über die die meisten Henker aber nicht verfügten.
Im alten Rom wurden die Verurteilten meist an einem einfachen, etwa zwei Meter hohen Pfahl, dem crux, gebunden oder genagelt. Manchmal befanden sich auch zwei Verurteilte an einem Pfahl.
In einigen Fällen wurde der Verurteilte auch mit Nägeln oder Seilen an dem Querbalken (patibulum) festgemacht. Manchmal mußte er diesen bis zur Richtstätte tragen. Dort wurde er seiner persönlichen Habe beraubt, welche unter den Henkern verteilt wurde. Danach wurde er gefoltert. Der Querbalken mit dem Delinquenten wurde nun auf den Pfahl hochgezogen und befestigt. Die Füße wurden nun ebenfalls genagelt oder gefesselt, manchmal ließ man sie auch frei baumeln. In einigen Fällen wurde unter dem Gesäß des Verurteilten ein kleines Brett, eine Art Sitz, befestigt, so das der Delinquent sein Körpergewicht verlagern und seine strapazierten Arme entlasten konnte. Letztendlich vergrößerte dies aber das Leiden - das Opfer lebte länger und es dauerte bis zu drei Tagen, bis er das Bewußtsein verlor.
Was empfindet ein Mensch, der am Kreuz hängt?
Zunächst jagen Wellen des Schmerzes durch seinen Körper. Wenn er sich schlaff hängen läßt, verkrampfen nach kurzer Zeit die Armmuskeln. Wurde er genagelt, kommt der durch die Wunden hervorgerufene Schmerz noch hinzu, der durch die Zugkräfte auch noch immer größer wird. Versucht der Angeklagte seine Arme zu entlasten, indem er sich am Kreuz aufstemmt, geschieht dasselbe nach kurzer Zeit mit den Beinen.
Der Tod selbst tritt durch einen schleichenden Kreislaufzusammenbruch ein, da durch die Bewegungslosigkeit der Beine der Blutdruck zu sinken beginnt. Es droht ein Kreislaufkollaps. Das erlöst das Opfer aber nicht von seinen Leiden, da sich der Körper auf die Notsituation einstellt und neue Kräfte mobilisiert. Da das Blut langsamer durch die Adern fließt, bilden sich Thrombosen. Werden von diesen Blutklümpchen wichtige Blutgefäße verstopft, droht eine Unterbrechung der Blutzufuhr zu den Lungen. Zu den Leiden des Opfers kommen nun auch noch die durch Erstickungsanfälle und Atemnot hervorgerufene Panikattacken hinzu. Zu all dem war das Opfer auch noch nackt und hilflos Wind, Sonne und nächtlicher Kälte ausgeliefert. Das Sterben dauerte meist mehrere Tage.
Das Leiden konnte verkürzt werden, wenn die Henker ihren Opfern vorher die Beine brachen. Durch diese Aktion konnte der Verurteilte sich nicht mehr am Kreuz aufrichten und der Kreislauf brach schneller zusammen.
Die Verurteilten bleiben am Kreuz hängen, bis sie von wilden Tieren gefressen worden waren. Dadurch sollte den Verurteilten der Zugang ins Totenreich verwehrt werden. Dies war für die Verurteilten eine zusätzliche psychische Belastung. Eine Ausnahme wurde nur für die Juden gemacht, da die Römer auf die jüdische Gesetz Rücksicht nahmen, wonach ein Gehängter bis zum Sonnenuntergang bestattet werden mußte.
Gekreuzigt wurde meist auf Anhöhen vor der Stadt. Die Kreuzigung galt in Rom als schimpfliche Strafe und blieb Sklaven, Raubmördern und Rebellen vorbehalten. Freie Bürger oder Frauen wurden nicht gekreuzigt.